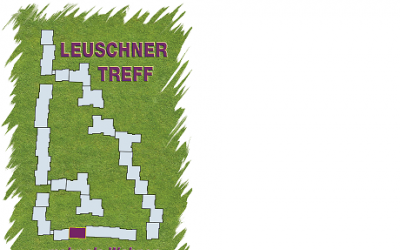Der Quakenbrücker Stadtteil Neustadt ist gekennzeichnet durch städtebauliche Mängel, soziale Problemlagen und Spannungen im Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das „Soziale Stadt“ Projektgebiet weist eine hohe Konzentration von MigrantInnen mit schwachen Integrationsvoraussetzungen und einen hohen Anteil an SGB II- EmpfängerInnen auf. Der Zugang zu bestimmten MigrantInnengruppen erweist sich seit Jahren als schwierig. Es gibt nur wenige MultiplikatorInnen und eine geringe Bereitschaft, das Leben im Stadtteil aktiv mitzugestalten. Einige der in der Neustadt ansässigen MigrantInnenvereine (u.a. Islamischer Kulturverein, Sportverein Schwarz-Weiß Quakenbrück) sind noch jung und benötigen Unterstützung in ihrer weiteren Entwicklung. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit und zwischen (MigrantInnen)vereinen in der Neustadt bietet die Chance, Konflikte, Hemmschwellen und Unsicherheiten im Kontakt und dem Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft im Stadtteil langfristig zu verringern und weitere Ressourcen zu erschließen. Hierzu bedarf es den Aufbau von Gemeinwesenarbeit, da eine intensive gemeinwesenorientierte Sozialarbeit durch das Quartiersmanagement alleine nicht geleistet werden kann. Auch insgesamt mangelt es im Stadtteil an Selbstorganisation und Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements. Die Etablierung einer Stadtteilinitaitve als Plattform für BürgerInnen, das soziale und kulturelle Leben in der Neustadt aktiv mitzugestalten und die Entwicklung des Stadtteils positiv zu beeinflussen, ist auch im Hinblick auf die zeitliche Begrenzung der Förderung durch das „Soziale Stadt“-Programm besonders wichtig.
Ergänzung Projektjahr 2018:
Vor dem Hintergrund des späten Projektbeginns im Oktober 2017 kann die Ausgangslage im Stadtteil als unverändert beschrieben werden.
Ergänzung Projektjahr 2019:
Im Projektjahr 2018 hat sich im Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit dem mobilen Stadtteilbüro an unterschiedlichen Standorten in der Neustadt gezeigt, dass der Stadtteil und seine BewohnerInnenschaft viel heterogener ist, als noch zu Beginn des Projekts vermutet. Je nach Standort des Bauwagenbüros und je nach Personengruppe (z.B. jung/alt, mit/ ohne Migrationshintergrund) wurden teils sehr unterschiedliche Problemstellungen, Bedürfnisse und Interessen identifiziert. Zudem wurde deutlich, dass zu Beginn viel Erklärung, Unterstützung und Zeit nötig ist, um vertrauensvolle Bezüge aufzubauen und Menschen zu motivieren, in ihrem Wohnumfeld aktiv zu werden. Besonders für Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht lange in Deutschland leben, erscheint die Möglichkeit einer Beteiligung am Stadtteilleben oder gar die Mitarbeit in einer Stadtteilinitiative noch recht weit entfernt. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und Erkenntnisse wurden die Haupt- und Unterziele des Projekts an einzelnen Stellen angepasst. So soll der aufsuchenden Arbeit im Projekt sowie den hierbei identifizierten Bedürfnissen und Interessen der BewohnerInnen zunächst mehr Raum gegeben werden, um auf dieser Grundlage kleinere Projekte und Aktionen zu initiieren, die Begegnung fördern und zu weiterer Selbstorganisation anregen. Die Gründung einer Stadteilinitiative wird nicht aus den Augen verloren, jedoch kann dies nur ein langfristiges Projektziel darstellen, welches viel Vorarbeit bedarf.
Ergänzung Projektjahr 2020:
Auch im Projektjahr 2019 wurde deutlich, dass es auf Seiten der Bewohner*innen große Hürden und Hemmschwellen gibt, sich längerfristig an neuen Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements (wie z.B. einer Stadtteilinitative) zu beteiligen. Die Heterogenität des Stadtteils und seiner Bewohner*innen erschwert es zudem, gemeinsame Ziele zu definieren. Die Erfahrungen der letzten Projektjahre haben gezeigt, dass ein Einbezug der Bewohner*innen besser über „greifbare“ und zeitlich begrenzte Vorhaben funktioniert. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des 3. Hauptziels kleinere Teilprojekte bzw. Initiativen ausgewählt, die im kommenden Jahr intensiver begleitet und unterstützt werden sollen. Hierzu zählen die Nahversorgungssituation im Stadtteil (aufgrund der Schließung eines Supermarkts ist das Einkaufen vor allem für ältere Bewohner*innen zum Problem geworden) sowie die Aufwertung der bisher als negativ und „unsauber“ wahrgenommenen Kleingartenanlage im Stadtteil unter Einbezug der Ideen und Ressourcen der Pächter*innen.
Das in 2019 eingerichtete Nachbarschaftsbüro in der Tilsiter Straße stellt einen wichtigen neuen Standort für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Neustadt dar. Bei der Tilsiter Straße handelt es sich um ein Wohnquartier, welches mit einem Negativimage belastet und von Nachbarschaftskonflikten geprägt ist. Vor diesem Hintergrund erweist sich das Vor-Ort Büro als besonders hilfreich, um eine Vertrauensbasis zu den Bewohner*innen aufzubauen und sie zur Mitgestaltung des Zusammenlebens im Quartier zu aktivieren.
Ergänzung Projektjahr 2021:
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Monate lang keine oder nur sehr begrenzt Aktivitäten im Quartier organisiert werden. Besonders betroffen waren bzw. sind die Gruppenaktivitäten im Nachbarschaftsbüro in der Tilsiter Straße, da es sich hierbei um eine kleine Wohnung handelt, in der die Abstandsregelungen nur schwer eingehalten werden können. Aufgrund der anstehenden Umbauarbeiten ist es zudem unklar, wie lange die Wohnung überhaupt noch genutzt werden kann. Die Gemeinschaftsparzelle in der Kleingartenanlage bietet zumindest für die Sommermonate großes Potenzial, sich zu einem Begegnungsort für die Menschen im Quartier zu entwickeln. Gerade auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie stellt der Garten als Treffpunkt im Freien einen idealen Ort für Begegnung dar. Dennoch muss mit dem Wegfall des Nachbarschaftsbüros in der Tilsiter Straße langfristig ein neuer fester Standort gefunden werden, an dem sich die Gemeinwesenarbeit in der Neustadt weiterentwickeln kann.